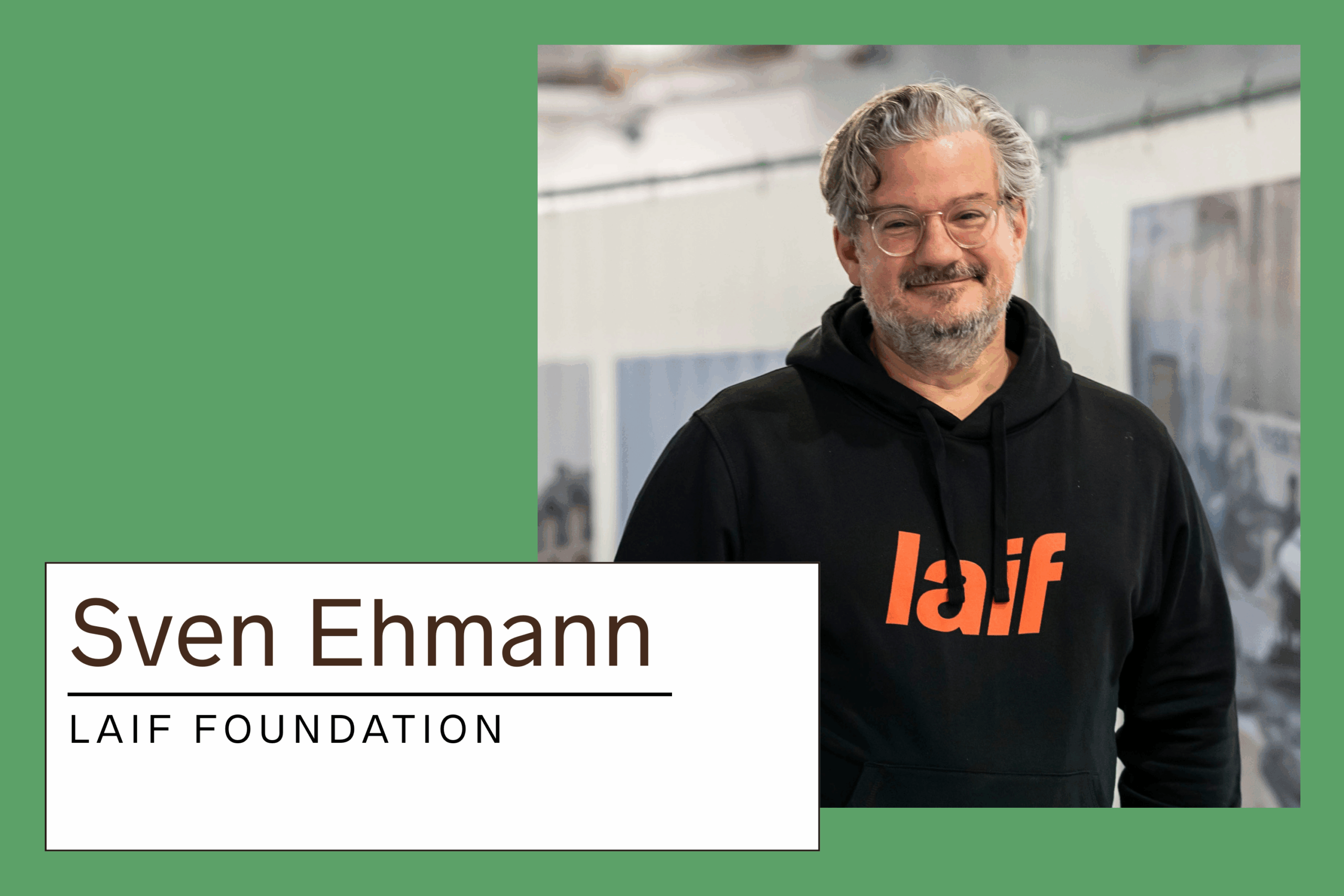Wofür steht die laif foundation?
laif steht für guten, glaubwürdigen und unabhängigen Fotojournalismus. Und unser Ziel als laif foundation ist es, die Gesellschaft für den Wert dieser Art Fotojournalismus zu begeistern. Wir stellen fest, dass die Bedeutung der Bilder steigt, weil alle immer mehr visuell kommunizieren und sich auch so informieren. Damit die Wertschätzung für Fotojournalismus und die Arbeit von Bildautor:innen ebenfalls zunimmt, machen wir Angebote, durch die Menschen lernen können, was diese neue Visualität eigentlich bedeutet, wie wir uns ausdrücken, wie wir Bilder wahrnehmen, wie wir sie kritisch hinterfragen können und müssen. Wir bieten den Raum für mehr Verständnis und Diskurs zu fotojournalistischen Bildern in der Gesellschaft und fördern so auch die Demokratie.
Wie kam es zur Gründung der laif foundation?
Der Kern von laif ist eine Bildagentur, die seit fast 45 Jahren existiert. Vor drei Jahren haben die Fotografierenden die Kontrolle und Verantwortung für ihre Bilder übernommen und dafür eine Genossenschaft gegründet. Im zweiten Schritt entstand dann die Idee und das Bedürfnis, noch eine gemeinnützige Tochter zu gründen. Das ist die laif foundation, eine gGmbH, die gesellschaftlich wirkt und auch mit den Partnerorganisationen und Fördergeber:innen an Themen arbeitet.
Welche Ziele verfolgt ihr?
Wir engagieren uns für einen starken unabhängigen Fotojournalismus, eine informierte Gesellschaft und eine gestärkte Demokratie. Weil diese Sachen aufeinander aufbauen und sich in unserem Verständnis auch gegenseitig bedingen. Wir brauchen als Gesellschaft ein gemeinsames Bild von dem, was gerade passiert, um darüber diskutieren zu können. Und nur, wenn wir im Gespräch bleiben und uns austauschen, uns an Themen reiben und Meinungen aushalten, ist das eine Demokratie. Jetzt, wo immer mehr Bilder im Umlauf sind und wir immer weniger wissen, woher diese Bilder stammen und ob sie von Menschen oder von Maschinen gemacht sind, wird Medien- und Bildkompetenz besonders wichtig. Dafür machen wir Projekte. Es geht aber auch darum, dass diese Bilder überhaupt weiterhin entstehen können. Dass Menschen davon leben können, die Bilder zu machen, an die wir uns alle erinnern. Zu Ereignissen wie „Mauerfall“ oder „9/11“ haben wir wahrscheinlich sehr ähnliche Bilder im Kopf, während wir uns nicht mehr daran erinnern, was die Überschriften der Zeitungen dazu waren. Diese Kraft, Qualität und auch gesellschaftliche Bedeutung von Fotojournalismus wollen wir wieder mehr ins Bewusstsein holen. Für die Gesellschaft, für die Medien und für die Fotografierenden.
In welcher Phase befindet ihr euch zurzeit?
Wir sind noch sehr am Anfang. Es gibt uns seit zwei Jahren. Dafür ist schon viel passiert. Nach einer Start- und Findungsphase haben wir bislang zwei Ausstellungsprojekte unterstützt und drei größere, eigene Projekte umgesetzt. Einen bundesweiten Jugendfotowettbewerb, um Jugendliche zu aktivieren, ihre Themen mit ihren Mitteln zu formulieren, also mit dem Smartphone und mit ihrer Bildsprache. Da ist jetzt die erste Runde mit Preisverleihung und einer Ausstellung im Publix abgeschlossen. Daran angeknüpft bieten wir Medienkompetenz-Workshops für Schulen an. Und das dritte Projekt war ein spontan organisiertes Fotofestival in Hamburg, das mit Ausstellung und einem Vermittlungsprogramm schon Komponenten unseres Formats BildBotschaft beinhaltet, das im Herbst 2025 so richtig startet.
Worum geht es konkret in diesem Format?
Der Ausgangspunkt der BildBotschaft ist die Erkenntnis, dass es unserer Gesellschaft und Demokratie an Austausch zwischen denen mangelt, die unterschiedlicher Meinung sind. Dieser Austausch, aus dem Kompromisse und ein gesellschaftliches Miteinander entstehen sollten, wird immer weniger. Bilder haben eine besondere Kraft, solche Gespräche möglich zu machen, weil man sich weniger direkt mit Sprache, Begriffen und Argumenten aneinander abarbeitet, sondern über Bande spielt. Man kann über ein Bild einen entspannteren Einstieg in ein Gespräch finden, besser abgleichen, was gesagt und gemeint ist, und wird dadurch einen respektvolleren und vielleicht auch konstruktiveren Umgang miteinander erreichen. Die Idee der Bildbotschaft ist, dass wir genau das möglich machen, indem wir einen realen Raum dafür schaffen. Konkret ab November in der Hamburger Innenstadt, in der Fußgängerzone in unmittelbarer Nähe vom Hauptbahnhof. Dort beziehen wir ein temporäres Gebäude und zeigen im Erdgeschoss mit einem Schaufenster Bilder, die zum einen von professionellen Fotograf:innen aus dem laif-Pool stammen, aber vor allem auch von unterschiedlichen Gruppen in der Stadt. Wir starten zum Beispiel eine Jugend-Bildredaktion, die im Vorfeld aber auch begleitend immer wieder Bilder macht und so ihre Perspektive auf lokal relevante Themen anbietet. Dann gibt es ein Projekt mit Migrant:innen, die ebenfalls ihren Blickwinkel auf die Stadt formulieren werden. Und wir hoffen, dass wir es bis dahin schaffen, noch viel mehr Partnerorganisationen vor Ort zu gewinnen und auch das Geld dafür zu finden. So soll ein vielfältiges, multiperspektivisches Panorama entstehen, das nicht nur eine Antwort auf ein Thema bietet, sondern eine Mischung aus vielen Blickwinkeln.
Wie fördert eine solche Anordnung den Dialog?
Aus dem Festival im letzten Jahr wissen wir, dass mit dem Betrachten der Bilder sehr viel Gesprächsbedarf entsteht. Dafür bieten wir vor Ort verschiedene Dialog- und Vermittlungsformate an. Das Team wird Fragen beantworten, aber auch selbst ins Gespräch gehen und versuchen, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Außerdem werden wir immer wieder Events mit thematischen Schwerpunkten anbieten. Zum Beispiel wollen wir zusammen mit Partnerorganisationen und ihren Communities durch die Ausstellung gehen und schauen, was uns die Bilder zu deren Thema sagen und vielleicht auch welche Bilder fehlen, was unsichtbare oder verschwiegene Positionen sind. Das Ganze ist ein Prototyp. Wir wollen diese Vermittlungsarbeit in verschiedensten Formaten ausprobieren. Wenn das funktioniert, sind BildBotschaften auf sehr unterschiedliche Arten skalierbar. Man kann sie kurz und lang machen, klein und groß, in allen möglichen verschiedenen Räumen, auch in Bibliotheken oder in Schulen. Und man kann sie auf die jeweils lokal relevanten Themen zuschneiden, damit sie für die Menschen vor Ort einen Wert haben.
Wer ist die Zielgruppe der BildBotschaft?
Wir hoffen, dass die Besucher:innen in Hamburg so bunt sind, wie die Menschen, die in der Vorweihnachtszeit durch die Fußgängerzone schlendern. Im vergangenen Herbst waren wir mit unserem Festival in einem temporären Kulturkaufhaus in unmittelbarer Nähe. Da waren wir im dritten Stock, die Rolltreppe funktionierte nicht immer und trotzdem kamen in zehn Tagen 6.000 Leute vorbei. Zum Teil, weil sie sowieso im Haus waren, zum Teil, weil es ihnen draußen zu kalt war oder sie den Zug verpasst hatten. Diese Mischung war super interessant und an der Stelle wollen wir weitermachen. Die Fußgängerzone ist als Ort dafür optimal. Ich fände auch spannend, herauszufinden, ob das auch in einem Supermarkt funktionieren würde, in einem Baumarkt, im Fußballstadion oder in einer Unterführung. Wir wollen die Bilder zu möglichst vielen, verschiedenen Menschen bringen.
Wie viele Menschen benötigt man, um so einen Ort zu bespielen?
Während der normalen Öffnungszeiten müssen mindestens zwei Leute vor Ort sein. Parallel haben wir die Jugendredaktion, in der nochmal zwei Leute mit einer Gruppe in regelmäßigen Treffen wie in einer gläsernen Redaktion in der BildBotschaft arbeiten. So dass man dabei zuschauen kann, wie die Bilder entstehen. Eine Person begleitet und leitet das Projekt durchgehend. Und dann kommen regelmäßig noch Leute dazu, die Impulse mitbringen. Also zum Beispiel haben wir eine Fotografin, die etwas zum Thema Portrait machen wird, und jemanden, der etwas zum respektvollen Umgang beim Fotografieren sagen kann. Bei Events und für Auf- und Abbau kommen Leute dazu, für Kommunikation und Projektmanagement. Es wird ein Kernteam von fünf Personen geben und insgesamt werden sicherlich fast 30 Leute dran arbeiten. Aber nicht jeden Tag, sondern punktuell.
Wie finanziert ihr den Prototypen?
Überwiegend mit Fördergeldern von der Zeit Stiftung Bucerius, von der Michael-Otto-Stiftung und von der Stiftung Mensch und Mensch. Es sind noch Anträge offen, aber da es von Anfang an absehbar war, dass das klassische Förderungsmodell schwierig wird, versuchen wir, drei Säulen für dieses Projekt zu nutzen. Die eine ist die Förderung, die zweite ist ein Crowdfunding, das auch Aufmerksamkeit weckt. Die dritte Säule ist, vor Ort Sponsoringpartner zu finden.
Wie ist die zeitliche Perspektive für weitere BildBotschaften?
Unser Horizont ist im Moment die nächste Bundestagswahl. Wir wollen schauen, dass wir in dieser Zeit im Norden, Süden, Osten, Westen und in der Mitte Deutschlands jeweils eine BildBotschaft veranstalten. In welchem Format, in welcher Größe und auch in welchen Örtlichkeiten hängt natürlich sehr davon ab, wie sich das erste Projekt jetzt entwickelt. In Hamburg wird es so sein, dass wir mindestens zwei Monate lang fast jeden Tag geöffnet haben, und dann gibt es noch dieses Treffen der jungen Bildredaktion dazu. Wenn es woanders aber weniger Zeit gibt, dann kann eine BildBotschaft auch anders geplant werden und trotzdem ihre Wirkung entfalten. Wichtig ist, dass es eine gewisse Kontinuität und Beiträge aus den unterschiedlichen Gruppen gibt. Wir wünschen uns, dass BildBotschaften irgendwann dauerhaft an verschiedenen Orten betrieben werden. Und wenn dann mehrere BildBotschaften existieren oder existiert haben, werden wir die Ergebnisse dokumentieren und als Ganzes sichtbar machen.
Welche Herausforderungen habt ihr bereits erkannt?
Die größte Herausforderung ist es, das Geld zusammenzubekommen und die Zeit zwischen Antrag und Zu- oder Absage zu überbrücken. Das ist gerade für junge Organisationen superschwierig. Ansonsten ist es viel Fleißarbeit, jeweils die richtigen Orte und Leute zu finden, die das Projekt unterstützen. Wir sind gespannt darauf, welche Dynamik diese Dialogformate vor Ort bekommen, gerade wenn Leute unterschiedlicher Meinungen sind. Wir arbeiten gerade daran, wie wir diese Dynamiken moderieren und wie wir das Team vor Ort befähigen, damit umzugehen können. Das ist vielleicht die wichtigste Herausforderung. In unserem Verständnis ist zum Beispiel die Jugendbildredaktion eine Art Safe Space für die Teilnehmenden. Sie entwickeln ihre Themen in der Gruppe, setzen Bildideen um, es wird darüber diskutiert, man versucht gemeinsam weiterzukommen. Das bedeutet auch, dass Teilnehmende sich hinstellen und sagen: Okay, das Bild habe ich gemacht und das ist der Grund dafür oder das meine ich damit. Und dass andere darauf reagieren und sagen können, ob sie das verstehen oder welche Fragen sie dazu haben. Und dann muss man eben auch aushalten, dass manche sagen: Das Bild trifft es für mich überhaupt nicht. Damit kommen wir zurück zum Anfang und zum Ziel des Projektes. Wir wollen einen Rahmen bieten, in dem die Menschen eben nicht einfach nur auf Positionen beharren, sondern ins Gespräch gehen. Und deswegen ist die BildBotschaft aus unserer Sicht auch ein lokaljournalistisches Format, weil es so möglich wird, dass eine Gemeinschaft sich über ihre Themen informiert und austauscht.
Könnten Lokal- und Regionalverlage ein Format wie die BildBotschaft für sich adaptieren?
Absolut. Wir würden uns freuen, mit lokalen Partnerorganisationen zusammenzuarbeiten und gemeinsam herauszufinden, was vor Ort funktioniert. Themen und Formate können sich ja auch immer wieder verändern. Dadurch, dass wir einen Pool von knapp 400 laif Fotograf:innen in ganz Deutschland haben, gibt es fast immer jemanden, der oder die in einer Gegend fotografiert hat und als Teil dieser Region mitwirken oder reden kann. Dieses Potenzial wollen wir auch nutzen. Unsere Hoffnung ist ja auch, die Bedeutung von lokalem Fotojournalismus und die Wertschätzung zu steigern. Auch wäre die Zusammenarbeit mit Lokalmedien super.
Sven Ehmann
Sven Ehmann ist Director of Strategy & Development der laif foundation. An der Schnittstelle von Fotografie, Medienbildung und öffentlichem Dialog entwickelt er Formate wie die BildBotschaft, die visuelle Medienkompetenz mit demokratischer Beteiligung verbindet.
laif foundation
Die aus der Bildagentur laif als gemeinnützige GmbH ausgegründete laif foundation setzt sich für Wahrnehmung, Wertschätzung und die gesellschaftliche Bedeutung von Fotojournalismus ein. Die Non-Profit-Organisation finanziert sich zu einem großen Teil aus privaten Spenden und aus Zuwendungen von Stiftungen und Institutionen.
Website: laif-foundation.org